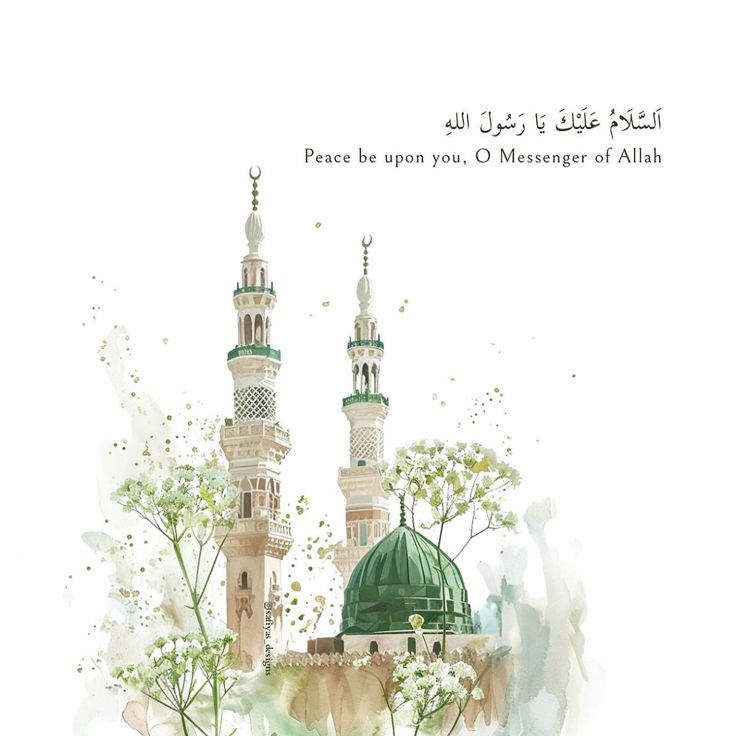Der Begriff naẓm und die Auseinandersetzung damit in der muslimischen Tradition
Der Begriff naẓm stammt im Arabischen von der Wortwurzel na-ẓa-ma, was „aufreihen; ordnen, in Ordnung bringen“ und im II. Stamm (naẓẓama) organisieren; regeln“ bedeutet. Naẓm kann übersetzt werden mit „Aneinanderreihung; Ordnung, Anordnung; System“. Im klassischen Arabisch heißt es naẓamtu al-luʾluʾa ai ǧamaʿtuhu fī as-silki; „Ich habe die Perlen in einem Faden aneinandergereiht“ und tanāẓamat aṣ-ṣuḫūru: talāsaqat „die Felsen, Steinblöcke; Steinmassen haften aneinander oder gehen ineinander über“. Al-intiẓām bedeutet al-ittisāq „Harmonie“. Das Wort naẓīm wird für eine Reihe von Brunnen verwendet, die systematisch ausgegraben wurden bzw. entsprechend eines Planes.
Der Begriff und das Konzept vom naẓm im Koran entspringt vermutlich den Diskussionen rund um den sog. iʿǧāz des Koran, seiner Unnachahmlichkeit. Die muslimischen Wissenschaftler sind unterschiedlicher Meinung worin der iʿǧāz genau liege. Einige waren der Ansicht iʿǧāz liege im naẓm des Koran. Das Verständnis vom naẓm selbstkann grob in zwei Kategorien eingeteilt werden: Eine Kategorie von Wissenschaftlern und Exegeten, die naẓm in Begriffen der Rhetorik (balāġa) verstanden, und eine, die darunter die intertextuellen Verknüpfungen (tanāsub) von āyāt und Suren verstanden.
Zu ersten Kategorie zählen Autoren wie al-Ḫaṭṭābī (319-388/ 931-998), al-Bāqillānī (338-403/ 950-1013), al-Ǧurǧānī (gest. 471 n.H./ 1078) und az-Zamaḫšarī (467-538/ 1075-1144). In den Studien zur Rhetorik und Stilistik (ʿilm al-balāġa) der arabischen Poetik verstanden die Autoren unter naẓm die Anordnung von Wörtern in einem Satz angesichts ihrer syntaktischen Beziehung zueinander. Al-Ḫaṭṭābī ist der erste, der diese Art von naẓm als Teil des iʿǧāz des Korans in seinem Kitāb Bayān iʿǧāz al-qurʾān beschrieb: Der Koran „brachte die eloquentesten Wörter in der besten Form der Komposition hervor“ (ǧāʾa bi-afṣaḥi-l-alfāẓi fī aḥsani nuẓūmi-t-taʾlīfi). Die Eloquenz einer Aussage wird durch drei Elemente gemessen: die Wörter (lafẓ, Pl. alfāẓ), die beabsichtigten Bedeutungen (maʿna, Pl. maʿānī) und die Komposition (naẓm). Für al-Ḫaṭṭābī ist letzteres wichtiger als die ersten beiden Elemente, denn naẓm ist für ihn die Art und Weise, wie die Wörter in einer Rede angeordnet sind, um die beabsichtigten Inhalte verständlich zu machen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine schlechte Anordnung der Wörter die Verdeutlichung der beabsichtigen Inhalte verhindert und der Sinngehalt nicht mehr vermittelt werden kann.
Ähnlich wie al-Ḫaṭṭābī führen al-Bāqillānī in seinem Iʿǧāz al-qurʾān und al-Ǧurǧānī in seinem Dalāʾil al-i`ǧāz den naẓm der Rede im Koran als Beleg für seine Unnachahmlichkeit an. Al-Ǧurǧānī geht über die einfache Grammatik (naḥū), bei der die möglichen Anordnungen der Wörter begrenzt sind, hinaus. Dabei hebt er komplexere grammatikalische Strukturen, bei der die Position der einzelnen Satzkomponenten signifikant ist, hervor. Wie beispielsweise definite (taʿrīf) und indefinite (tankīr) Wörter (Determination), Inversion (taqdīm: Voranstellung, taʾḫīr: Nachstellung), Ellipse (ḥaḏf), Repetitio bzw. Wiederholungen (takrār). Diese haben selbst eine bestimmte Aussagekraft und können für die Bedeutungsebene entscheidend sein. Er nennt sie maʿānī an-naḥū. Az-Zamaḫšarī leitet seinen Tafsīr mit den Worten „Alles Lob und Dank gebührt Allāh, der den Koran als eine zusammengesetzte systematisch geordnete Rede hinabgesandt hat (al-ḥamdu li-llāhi-llaḏī anzala-l-qurʾāna kalāman muʾallafan munaẓẓaman)“ ein. Sein Verständnis von naẓm unterscheidet sich im Grunde genommen nicht von dem von al-Ḫaṭṭābī, al-Bāqillānī (338-403/ 950-1013) und al-Ǧurǧānī. Was ihn jedoch hervorhebt und von den anderen Autoren unterscheidet ist, dass er sich nicht nur mit der Struktur der koranischen Sätze auf der Ebene der Grammatik und Rhetorik befasst, sondern gleichzeitig versucht, die Intertextualität zwischen āyāt einer Passage aufzuzeigen.
Für alle Autoren übertrifft der Koran aufgrund seiner grammatikalisch-rhetorischen Strukturen jede andere Rede. Sie etabliertendamit insgesamt einen ergänzenden, neuen Trend der Koran-Exegese.
In der klassisch-muslimischen Tradition entwickelte sich somit eine Wissenschaft mit dem Namen ʿilm al-munāsabāt als Teilwissenschaft der Koranwissenschaften (ʿulūm al-qurʾān), welche sich mit der Beziehung einzelner āyāt aber auch Suren zueinander und Intertextualiät und Symmetrien im Koran auseinandersetzt. Hierin finden wir die zweite Kategorie der Koranexegeten, die sich mit dem naẓm des Koran auseinandersetzten und ein bestimmtes Verständnis davon prägen.
Dieses Verständnis geht zurück bis zu al-Ǧaḥiẓ (255/ 869) und al-Wāsiṭī (309/919), die als Erste Werke mit dem Titel naẓm al-qurʾān verfassten. Der Wissenschaftler Abū Bakr an-Nīsābūrī (318/931) stellte ebenfalls als einer der ersten während seiner Unterrichtssitzungen Fragen wie „Warum wurde diese ʾāya neben diese gesetzt?“ und „Welche Weisheit steckt hinter dem Setzen dieser Sure neben dieser?“. Dabei kritisierte er die Gelehrten von Bagdad seiner Zeit für die geringe Kenntnis über die Zusammenhänge zwischen den āyāt und den Suren.
In der klassisch-traditionellen Koranwissenschaft werden in der Wissenschaft „Intertextualität im Koran“ (ʿilm al-munāsaba) u.a. drei Hauptelemente analysiert:
- Analyse des Zusammenhangs aufeinanderfolgender āyāt
- Analyse des Zusammenhangs zw. der letzten āya einer Sure und ihrem Beginn
- Analyse des Zusammenhangs zw. dem Beginn einer Sure und dem Ende der vorhergehenden Sure.
Az-Zarkašī (794/1391) widmete diesem Thema in seinem Werk al-Burhān fī ʿulūm al-qurʾān ein ganzes Kapitel als Einleitung für diese Wissenschaft und ebenso as-Suyūṭī (911/1505) in seinem al-Itqān fī ʿulūm al-qurʾān, welches eine Art Zusammenfassung und Neubearbeitung der Arbeiten az-Zarkašīs darstellt. Die bekanntesten Koran-Exegeten, die in ihren koran-exegetischen Werken intra- und intertextuelle Entsprechungen im Koran erläutern, sind Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī (606/1209) mit seinem at-Tafsīr al-kabīr bzw. Mafātīḥ al-ġaib, al-Qurṭubī (671/1272) mit seinem al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-qurʾān, Niẓām ad-Dīn an-Nīsābūrī (gest. 728 n.H./1327) und sein Ġarāʾib al-qurʾān wa raġāʾib al-furqān, Abū Ḥayyān al-Andalūsī (745/1344) im Baḥr al-Muḥīṭ und Burhān ad-Dīn al-Biqāʿī (885/1480) mit einem der umfangreichsten Werke, dem Naẓm ad-durar fī tanāsub al-āyāt wa as-suwar, sowie aš-Širbīnī (gest. 977 n.H./1569).
Kleinere Werke über die Ordnung des Koran und Verknüpfungen sowie Zusammenhänge zwischen den Suren verfassten Abū Ǧaʿfar b. az-Zubair (gest. 708 n.H./1308), as-Suyūṭī (gest. 911 n.H./1505) sowie al-ʾĀlūsī (gest. 1270 n.H./1854).
Der bekannte andalusische Koran-Exeget und Jurist Abū Bakr b. al-ʿArabī (gest. 543 n.H./1148) ist von einer harmonischen Komposition des gesamten Koran überzeugt: „The verses of the Qurʾan are joined together in such manner that they are like a single word, harmoniously associated, structurally even.“ ar-Rāzī, einer der bekanntesten Vorreiter in diesem Bereich, meint, dass die meisten Feinheiten bzw. Besonderheiten des Koran sich in den Anordnungen (tartībāt) und Verbindungen (rawābiṭ) der einzelnen Teile des Koran finden. Einen besonderen Fokus auf Kohärenz, Komposition und inter- sowie intratextuelle Entsprechungen und Wechselbeziehungen der āyāt ist in seinem bekannten at-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīḥ al-Ġaib) erkennbar, wobei er unterschiedliche Begriffe wie ittiṣāl (Verbindung), taʿalluq (Verbundenheit), munāsaba sowie naẓm verwendet. naẓm ist für ihn ein bedeutsamer Faktor und ein Mittel der Koran-Exegese. Er geht sogar so weit, dass er einen überlieferten Offenbarungsanlass (sabab an-nuzūl) ablehnt, wenn dieser mit dem naẓm inKonflikt gerät.
Jedoch bleibt auch ar-Rāzīs Methode eine linear-atomistische:
Āya 1 einer Sure verbindet er mit āya 2, diese dann mit āya 3 und so weiter bis zum Ende der Sure und zeigt damit zwar die sprachliche sowie logische Verknüpfung der einzelnen āyāt auf, doch die Gesamtstruktur und Komposition einer Sure ist damit nicht unbedingt erkennbar.
Die Methode und Terminologie ar-Rāzīs wird weitestgehend von Niẓām ad-Dīn an-Nīsābūrī, Abū Ḥayyān, aš-Širbīnī und al-Ālūsī übernommen. Niẓām ad-Dīn an-Nīsābūrī teilt die Suren zusätzlich in Abschnitte und verknüpft diese thematisch miteinander. al-Ālūsī macht den allg. Kontext der āyāt zu einem Kriterium für ihre Interpretation. Dabei zeigt er den Zusammenhang einzelner Suren zueinander auf, nicht wie andere nur am Beispiel des Endes einer Sure und dem Beginn der nächsten, sondern durch konkrete Vergleichspunkte der Suren als Ganze.
Eines der wohl umfassendsten Werke der klassisch-muslimischen Tradition, welches sich intensiv mit dem naẓm des Koran auseinandersetzt ist das bereits erwähnte Naẓm ad-Durar fī tanāsub al-āyāt wa as-suwar von al-Biqāʿī. naẓm ist ein Leitmotiv bei al-Biqāʿī. Er selbst ist der Meinung, dass er der Erste sei, der die Prinzipien dafür niederlegt und den Koran auf diese Weise analysiert. Außerdem versucht er das Ziel und den Zweck (ġaraḍ) einer jeweiligen Sura mit ihrer Komposition (naẓm) in Einklang zu bringen. Der muslimische Jurist und Theologe ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām (660/1262) hingegen ist der Meinung, dass der Koran keine komplette Kohärenz (irtibāṭ) aufweise, weil er in einem Zeitraum von ca. 20 Jahren in sehr unterschiedlichen Kontexten hinabgesandt worden sei und die āyāt unterschiedliche Offenbarungsanlässe besäßen. Walī ad-Dīn al-Mallawī, einer der Lehrer az-Zarkašīs, widerspricht diesem Argument und meint, dass der Koran zwar entsprechend den historischen Umständen hinabgesandt wurde, jedoch entsprechend einer bestimmten Weisheit geordnet sei.
An-Nasafī (gest. 710 n.H./ 1142) erläutert die Aussage im Koran: „[…]dessen āyāt eindeutig festgefügt [sind]…(uḥkimat āyātuhū)“ mit: „[Die āyāt] wurden systematisch fest und perfekt geordnet, in ihm [dem Koran] kommt weder Unvollkommenheit noch Unordnung vor, wie ein festgefügter Bau“ (nuẓimat naẓman raṣīnan muḥkaman lā yaqaʿu fīhi naqṣun wa lā ḫalalun ka-l-binā al-muḥkam). Viele weitere Exegeten sehen das ähnlich.
Insgesamt beschäftigten sich jedoch eher wenige Exegeten der klassisch-muslimischen Tradition mit den munāsabāt oder dem naẓm des Koran, sodass sie keine umfassende Methode für die Strukturanalyse entwickelten. As-Suyūṭī beschreibt den Grund folgendermaßen: „Die Wissenschaft der Intertextualiät ist eine ehrbare bzw. achtbare, doch aufgrund ihrer nötigen Präzision und Feinheit haben sich die Koran-Exegeten eher weniger mit ihr auseinandergesetzt.“
Der Wissenszweig al-āyāt al-muštabihāt oder al-mutašābihāt, der sich mit den sich im Wortlaut und Stil ähnelnden āyāt auseinandersetzt, könnte man in den Bereich der Auseinandersetzung mit dem naẓm des Koran bei der Gelehrten und Wissenschaftlern der klassisch-muslimischen Tradition miteinbeziehen. Einige mutašābihāt nehmen in einigen Suren sogar einen refrainartigen Charakter ein und dienen der inneren Gliederung der Suren. Eine weitere wichtige Diskussion innerhalb der muslimischen Tradition im Bereich der Koranwissenschaften, und wichtig für die Strukturanalyse des Koran, ist die rund um tartīb al-āyāt wa as-suwar, der Ordnung der āyāt und Suren in der abschließenden Sammlung (muṣḥaf) und Kanonisierung des Koran. Während die muslimischen Wissenschaftler sich darüber einig sind, dass die Ordnung und Aneinanderreihung der āyāt innerhalb der Suren vom Propheten Muḥammad ﷺ durch seine Rezitation vorgegeben seien, wird darüber diskutiert, ob dies auch für die Ordnung der Suren gelte.
Auszug aus der Bachelorarbeit: Struktur und Kohärenz im Koran – „Semitic rhetoric“ als Werkzeug der Strukturanalyse an der Freien Universität Berlin
Abonniere Unseren Newsletter
Verpasse keine Veranstaltung & Neuigkeiten und erhalte alle Infos direkt in dein Postfach
Ähnliche Beiträge:
Dieser Beitrag bietet eine fundierte Einführung in die islamische Normenlehre [...]
Während meines Spaziergangs an diesem Morgen froren wieder meine Nase [...]
Im Folgenden geht es um eine Nachricht, die uns eine [...]